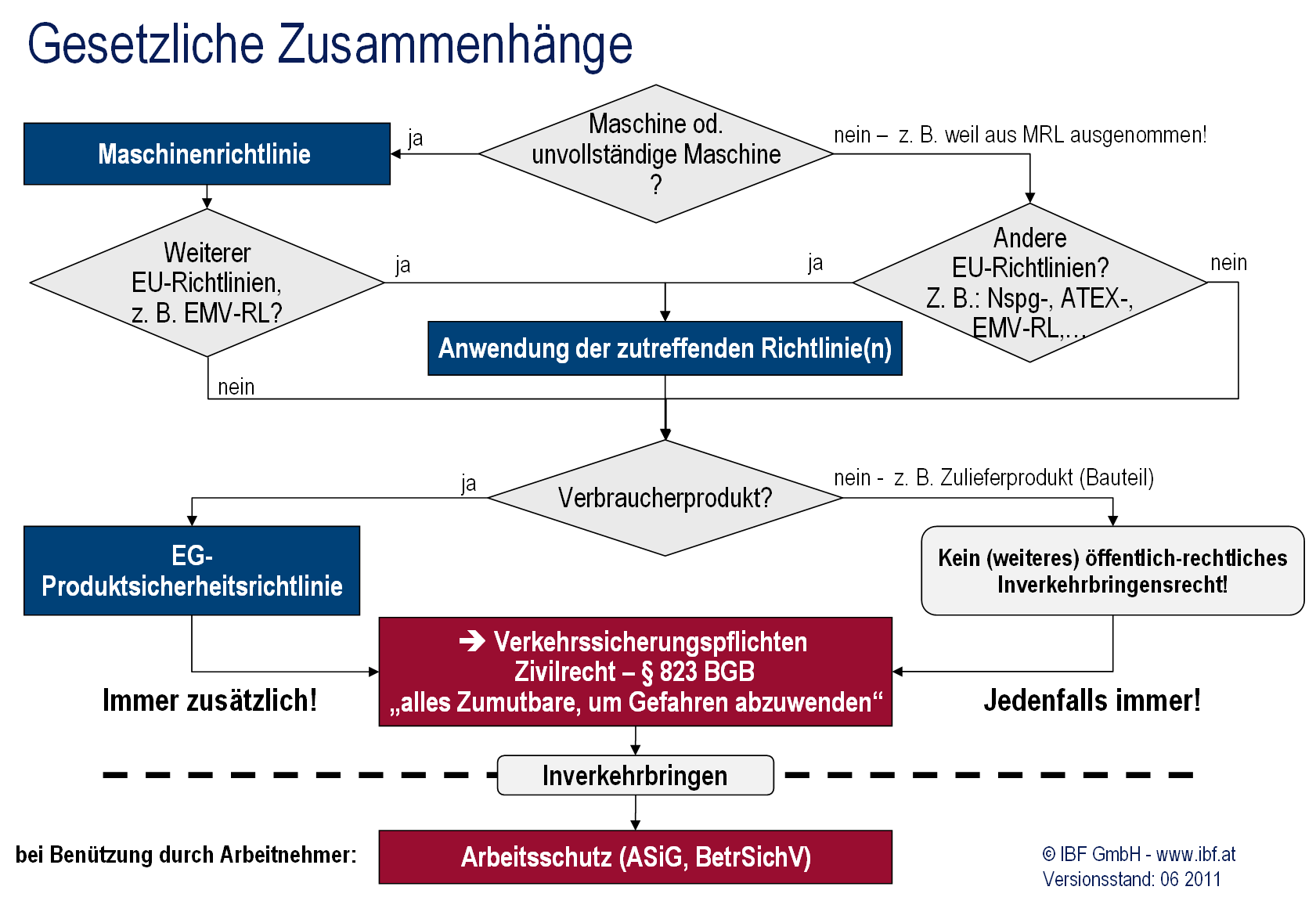„Der Expander“
BGH, Urteil v. 9.1.1990 – VI ZR 103/89
Sowohl Endhersteller als auch Zulieferer tragen im Bereich des Produkthaftungsrechts eine gemeinsame Produktverantwortung.
Sachverhalt:
Der Kläger verletzte sich 1982 durch einen hochschnellenden Expander am Auge infolge eines Bruchs des Kunststoffgriffs. Der Endhersteller bestellte die Griffe bei einem Auftragsfertiger und gab Formen vor, die einen Konstruktionsfehler beinhalten. Es wurden seit 1975 jährlich etwa 60.000 bis 75.000 Expander hergestellt. Der TÜV vergab nach einer Bauartprüfung das GS-Zeichen.
Der Verletzte verklagt den Griffhersteller auf DM 60.000,- Schmerzensgeld und den Ersatz aller materiellen Schäden.
Urteil:
Der BGH geht von einer – wenn auch im Vergleich zum Endhersteller geringeren – Sorgfaltspflicht des Zulieferers auch für die Endkonstruktion aus, verneint aber im konkreten Fall eine Pflichtverletzung.
Verkehrssicherungspflichten des Auftragsfertigers:
Der BGH spricht von „horizontaler Aufgabenteilung“ zwischen Auftragsfertiger und Endhersteller und umreißt die jeweiligen Pflichten so:
● Der Besteller hat die „Bestimmungsgewalt“ über „Konstruktion“ und „Materialauswahl“.
● Der Auftragsfertiger hat „in erster Linie die Fabrikationsverantwortung“.
Der BGH stellt aber klar, „dass auch ein Unternehmer, der auftragsgemäß nur die Fabrikation einzelner Produkte oder Produktteile für einen anderen Unternehmer übernimmt, für die Verkehrssicherheit dieser Produkte mitverantwortlich ist“ – und die bezieht sich auch auf die Konstruktion: „Da jeder an einer solchen Arbeitsteilung beteiligte Unternehmer auch in bestimmten Grenzen auf den Produktionsbeitrag des anderen zu achten hat, ist auch der Auftragsfertiger nicht von jeder Verantwortung für die Konstruktion des von ihm hergestellten End- oder Teilprodukts freigestellt“.
Der Zulieferer muss zwar nicht „die Konstruktion auf ihre Gefährlichkeit überprüfen“,
er hat aber Sorgfaltspflichten,
● „wenn die Konstruktion Fabrikationsfehler begünstigt“ und
● „wenn er bei der Ausführung der ihm übertragenen Tätigkeit die Gefährlichkeit der Konstruktion erkennen kann, sofern er konkreten Anlass für die Annahme haben muss, dass der für die Konstruktion Verantwortliche diesem Umstand nicht genügend Rechnung getragen hat“.
Keine Pflichtverletzung des Auftragsfertigers:
Der BGH verneinte im konkreten Fall indes eine Pflichtverletzung des Zulieferers, denn er habe keine Kenntnis von der Gefährlichkeit des Griffs und auch keine Überprüfungspflicht.
Keine Kenntnis des Zulieferers von Gefährlichkeit des Griffes:
Obwohl die Beklagte auf ihren Briefbogen ihre Fähigkeiten zur „Beratung, Planung, Konstruktion“ erwähnt und aus verschiedenen Veröffentlichungen, u.a. von dem Hersteller des verarbeiteten Kunststoffes, bereits darauf hingewiesen worden war, dass Kerben ausgesprochene Schwachstellen bilden, konnte der BGH keine Feststellungen zur Kenntnis der Beklagten von der Gefährlichkeit des Griffes treffen. Dazu „hätte noch hinzukommen müssen, dass die Beklagte auch hätte erkennen können, dass der ‚Schwachstelle‘ bei der vorgesehenen Verwendung des Expanders und der dabei auftretenden Kraftübertragungen eine so große Bedeutung zukam, dass dadurch die erforderliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Dazu hätte es zumindest der Feststellung bedurft, dass alle Kunststoffverarbeiter derartige Kenntnisse haben müssen bzw. dass die Beklagte in ihrem Unternehmen auch selbst-konstruierte Kunststoffprodukte hergestellt hat, die ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind wie die Expandergriffe“.
Keine Überprüfungspflicht:
Der BGH verneinte auch eine Überprüfungspflicht, weil der Zulieferer sich in konkreten Fall auf TÜV-Begutachtungen verlassen konnte:
„Im Streitfalle hatte die Beklagte auch keine besondere Veranlassung, die Konstruktion der Expandergriffe zu überprüfen, da die Prüfstelle des TÜV das Sportgerät einschließlich der von ihr hergestellten Griffe geprüft und dann das GS-Zeichen vergeben und der TÜV ein ähnliches Gerät bei einem Test mit „gut“ bewertet hat. Zwar wird ein Hersteller, der seine Produkte selbst konstruiert, nicht ohne weiteres von der Haftung für Schäden durch konstruktive Mängel seines Produktes freigestellt, wenn eine Prüfstelle es überprüft und derartige Mängel nicht festgestellt hat. Für andere in den Herstellungsprozess und den Vertrieb von Industrieprodukten eingeschaltete Unternehmer, die in Bezug auf Konstruktionsgefahren geringere Sorgfaltspflichten als der eigentliche Hersteller und Konstrukteur des Produktes zu erfüllen haben, gilt aber etwas anderes. So kann ein Importeur sich u.U. damit entlasten, dass er das eingeführte Gerät durch einen Sachverständigen überprüfen lässt oder es von einer zugelassenen Prüfstelle auf ihre Sicherheit untersuchen lässt. Dasselbe muss grundsätzlich auch für Auftragsfertiger gelten“.
Fazit und Merksätze und Empfehlungen:
- Auch der Auftragsfertiger/Zulieferer hat Sorgfaltspflichten nicht nur im Hinblick auf seine Fabrikation, sondern auch im Hinblick auf die Konstruktion des Endprodukts, wenn er die „Gefährlichkeit der Konstruktion erkennen kann“ und nicht davon ausgehen darf, dass der Endhersteller diesem Umstand Rechnung trägt.
- Die Beweislast für die Kenntnis bzw. die Erkennbarkeit des Zulieferers von der Gefährlichkeit liegt beim Geschädigten (vgl. auch Kullmann, ProdHaftG, 5. Aufl. 2006, § 1 Rn. 104).
- „Erkennen kann“ ein Zulieferer die Gefährlichkeit der Konstruktion, wenn er überprüft. Ob eine Überprüfungspflicht des Zulieferers besteht, hängt von seiner Kenntnis der Endverwendung und den weiteren Fallumständen ab. So kann die Kenntnis daraus folgen, dass der Zulieferer nicht nur nach strikten Vorgaben herstellt, sondern auch selbst Konstrukteur dieser Produkte ist und insoweit Konstruktionswissen hat.
- Die Rechtsprechung geht grundsätzlich davon aus, dass sich Importeure und Zulieferer auf Sachverständigengutachten verlassen können, verneint also in diesem Fall eine weitergehende Prüfungspflicht.
- Endhersteller und Zulieferer könnten und sollten die Aufgabenverteilung – und insbesondere den Umfang von Informations- und Überprüfungspflichten – im Vertrag festlegen.